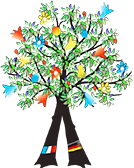- Vortragstext
- Oktober 2025
- Flugblatt: Link
 Vor 80 Jahren endete der 2. Weltkrieg und es begann eine Zeit des friedlichen Zusammenlebens von Franzosen und Deutschen, vielleicht sogar der Freundschaft - darüber kann man diskutieren. Aber auch nur Frieden ist schon viel, wenn man die deutsch-französische Geschichte betrachtet - im Grunde beginnt sie ja mit der Aufteilung des fränkischen Reichs im Jahr 843. In den 1100 Jahren bis 1945 herrschten vor allem Konkurrenz, Kampf, Krieg, Besatzung, Annektion, Niederlage und demütigende Friedensbedingungen zwischen beiden Ländern.
Vor 80 Jahren endete der 2. Weltkrieg und es begann eine Zeit des friedlichen Zusammenlebens von Franzosen und Deutschen, vielleicht sogar der Freundschaft - darüber kann man diskutieren. Aber auch nur Frieden ist schon viel, wenn man die deutsch-französische Geschichte betrachtet - im Grunde beginnt sie ja mit der Aufteilung des fränkischen Reichs im Jahr 843. In den 1100 Jahren bis 1945 herrschten vor allem Konkurrenz, Kampf, Krieg, Besatzung, Annektion, Niederlage und demütigende Friedensbedingungen zwischen beiden Ländern.
Aber Geschichte von Nachbarn ist glücklicherweise immer auch mehr als Machtpolitik, nämlich gegenseitige Beeinflussung im Alltag. Und die kann man am Beispiel Montbéliard-Württemberg sehr schön studieren.
Montbéliard liegt an der burgundischen Pforte, also in der Landschaft, die Elsass und Burgund verbindet. Durch geschickte Heiratspolitik gelingt es den Grafen von Württemberg, die kleine Grafschaft an sich zu bringen. Das ist ein längerer Prozess, der um 1400 beginnt und rund 50 Jahre dauert. Teilweise wird das Gebiet von Stuttgart aus regiert, teilweise halten Verwandte der in Stuttgart herrschenden Fürsten dort Hof. Montbéliard ist aber nie ein Teil von Württemberg, sondern sozusagen ein autonomes Gebiet unter der Herrschaft der Württemberger Grafen und Herzöge.
Und ganz wichtig: Mömpelgard heißt es bei württembergischen Beamten, Professoren und Adligen, Montbéliard wird Stadt und Grafschaft von seinen Bewohnern genannt. Dort wird Französisch gesprochen, und weil „die Sprache das Haus des Seins“ ist, wie Martin Hedegger formulierte, ist das natürlich nicht nur eine Aufgabe für gute Dolmetscher, sondern eine Frage des Fühlens und Denkens, der Kultur.
In der Mitte des 16. Jahrhunderts führen die württembergischen Herzöge die Reformation ein, auch in Montbéliard, was immer wieder Konflikte mit den katholischen Nachbarn erzeugt. Es bewirkt aber auch, dass sich protestantische Flüchtlinge aus Frankreich und der Schweiz in Montbéliard niederlassen, was sich als Segen erweist.
Nach dem 30-jährigen Krieg expandieren die französischen Könige verstärkt nach Osten, Ludwig XIV. nimmt Straßburg und das Elsass ein und auch Montbéliard wird zeitweise von französischen Truppen besetzt. Aber irgendwie gelingt es den württembergischen Herzögen durch geschicktes Taktieren und Lavieren zwischen den Großmächten Frankreich und Österreich Montbéliard als Exklave zu bewahren – bis zur französischen Revolution. 1792 besetzen Revolutionstruppen das Ländchen und läuten damit das Ende der württembergischen Herrschaft ein.
Von 1560 bis 1793 studieren fast 500 Stipendiaten aus Montbéliard am Tübinger Stift, der Ausbildungsstätte für protestantische Pfarrer in Württemberg. „Sie waren eine fremde, oft als frech empfundene Gemeinschaft, die die Obrigkeit durch ihre Andersartigkeit reizte. Alle Versuche seitens der Leitung die Mömpelgarder aufgrund mangelnder Lateinkenntnisse oder wegen Verhaltensverstößen auszuschließen oder sie durch eine Neuverteilung der Zimmer besser zu integrieren, scheiterten.“ So zu lesen in der Festschrift 'Ludwigsburg und seine Partnerstädte' aus dem Jahr 2010.
Und der Hölderlinforscher Adolf Beck schrieb, dass die Mömpelgarder bei der Stiftsleitung keinen guten Ruf hatten, da sie – Zitat - „Keimträger der Revolutionsideen waren.“ Dass sie trotzdem im Tübinger Stift und an der Universität, wo auch einige studieren, geduldet werden, liegt daran, dass die Obrigkeit dafür sorgen muss, dass genügend Pfarrer ausgebildet werden, die auch in Montbéliard den protestantischen Gottesdienst praktizieren können. Religion ist ein wichtiges Herrschaftsinstrument: cuius regio, eius religio, wer herrscht, bestimmt die Religion der Untertanen. Wer die Religion beherrscht, bestimmt ihr Denken. Dass die Anwesenheit der Studenten aus Montbéliard in Tübingen aber ein großes Glück ist für Württemberg und ja, man kann sagen, für Deutschland, dazu nachher mehr.
Was man allerdings nicht vergessen darf: Wir erinnern uns in diesem Jahr ja nicht nur an 80 Jahre Ende des 2. Weltkriegs, sondern auch an 500 Jahre Bauernkrieg. Mit ihren 12 Artikeln haben die Bauern und viele Städter im damaligen sogenannten Heiligen Römischen Reich versucht, dem Adel ein paar Freiheits- und Existenzrechte abzuringen. Ein Zentrum der Aufständischen war übrigens das Elsass, das damals ja noch zum römisch-deutschen Reich gehörte. Der Adel reagiert mit unglaublicher Grausamkeit auf diesen Aufruhr gegen seine Privilegien.
Auch in Montbéliard brodelt es damals offensichtlich, denn im Archiv liegt ein Brief des württembergischen Herzog Ulrich, der zur Zeit des Bauernkriegs zeitweise in Montbéliard im Exil lebt; in seinem Stammland ist er nämlich zu der Zeit unerwünscht, Württemberg wird von einem österreichischen Statthalter regiert.
Im Mai 1525, also am Höhepunkt des Bauernkriegs, schreibt Ulrich seinen „mömpelgardischen“ Untertanen, ihm sei berichtet worden, „das ihr euch ettlichre maß uffrürig unnd ungehorsam gegen der oberkeit (..) erzeigen und halten, das uns nit lieb und wir euch davor mit allen gnaden unnd getruwen gewarnt haben wolen.“
Die Unterdrückung der Bevölkerung durch den Adel soll nicht vergessen werden. Trotzdem, denke ich, dass sich das kleine Ländchen Montbéliard eignet, eines zu verdeutlichen: wenn sich zwei Kulturen begegnen, kann das unglaublich fruchtbar werden.
Bevor ich weiter in der Vergangenheit schürfe, noch etwas Zeitgeschichte: Montbéliard hat eine Städtepartnerschaft mit Ludwigsburg – schon seit 1950. Das ist die älteste oder doch eine der ältesten Städtepartnerschaften, die sich in der alten Bundesrepublik entwickelt haben – und sie wäre fast gescheitert.
In Ludwigsburg lebt Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre ein ehemaliger General der Waffen-SS, namens Sepp Dietrich. Dietrich war ein Duz-Freund Hitlers und hat schwerste Kriegsverbrechen begangen. Nach dem Krieg kam er mit wenigen Jahren Gefängnis davon. Als er im Jahr 1966 stirbt, gibt es im Ludwigsburger Neuen Friedhof eine Trauerfeier mit rund 5000 Altnazis. Es werden verbotene Lieder gesungen wie das Horst-Wessel Lied und ein ehemaliger General der Waffen-SS hält die Trauerrede.
Man stelle sich das mal vor: 4 Jahre nach De Gaulles berühmter Ludwigsburger Rede passiert sowas in der Stadt, in der ja zudem noch die Zentralstelle für die Aufklärung der NS-Verbrechen eingerichtet wurde!
Die Zeitschrift Paris Match berichtet und in Montbéliard ist man entsetzt. Das Ganze ist für die Franzosen auch deshalb so verstörend, weil der Begründer der Städtepartnerschaft und Bürgermeister von Montbélaird in den 50er Jahren, Lucien Tharradin, Mitglied der Résistance war und deshalb ein Jahr im KZ Buchenwald inhaftiert wurde.
André Boulloche, der 1966 Bürgermesier von Montbéliard war, teilt seinem Ludwigsburger Kollegen mit, dass er und seine Delegation nicht zu Feierlichkeiten in Ludwigsburg erscheinen werden. Er schreibt:
„Wir gedenken am 25. April den Deportierten und verneigen uns am 8. Mai vor dem Denkmal für die Gefallenen des Krieges. Unsere Mitbürger würden es nicht verstehen, wenn wir am 6. Mai in einer Stadt wären, in der vor 10 Tagen ein Aufmarsch ehemaliger Nazis stattgefunden hat.“
Durch die Vermittlung besonnener Leute kann dann ein Bruch der Partnerschaft gerade noch abgewendet werden.
Zurück nach Montbéliard, weg von der Politik und zur Kultur:
Ehrenfried Kluckert schreibt in seiner kulturgeschichtlichen Reise nach Mömpelgard, dass das Städtchen um 1600 ein Knotenpunkt für Literatur ist. Zwei Beispiele: Der Drucker Jacques Foillet, der aus der Gegend von Lyon stammt, verlegt zwischen 1587 und 1619 in Montbéliard zahlreiche wissenschaftliche und theologische Werke. Im Auftrag des späteren Herzogs Friedrich von Württemberg bringt er das Hauptwerk des französischen Juristen und Staatsrechtlers Jean Bodin „Les six livres de la République“ in einer deutschen Übersetzung heraus. Trotz des Titels propagiert Bodin darin allerdings nicht die Republik, sondern erklärt und begründet die absolute Herrschaft eines Fürsten. Ungefähr gleichzeitig wird der berühmte Schäferroman Astrée von Honoré d'Urfé vermutlich in Montbéliard auf Deutsch übersetzt und von dort in Deutschland verbreitet.
Wenn man bei Wikipedia einen Städtenamen eingibt, erscheint auch eine Reihe von Persönlichkeiten, die in der Stadt geboren wurden oder dort gelebt haben. Die Liste im Eintrag Montbéliard ist unglaublich lang für ein Städtchen, das im Mittelalter und der frühen Neuzeit nicht einmal 10 000 und heute weniger als 30 000 Einwohner hat. Darunter sind wirklich bedeutende Persönlichkeiten. Einige Beispiele:
- Nicolas Tournier, ein großer Maler des Barock in der Tradition Caravaggios. Seine Familie muss ihre Heimatstadt Besancon verlassen, weil sie Protestanten sind und lassen sich in Montbéliard nieder.
- Julius Friedrich Scharffenstein, Theologe und Autor, der mehrere Dramen von Voltaire ins Deutsche übersetzt.
- Der Anatom und Biologe, Johann Georg Duvernoy, der in St. Petersburg lehrt und forscht.
- Und ganz wichtig: die Brüder Georges und Frédéric Cuvier, Zoologen und Paläontologen. Georges Cuvier gilt als wissenschaftlicher Begründer der Paläontologie.
Schließlich noch eine ganz besondere Persönlichkeit, die Montbéliarde. Das ist eine sehr schöne braun-weiß gescheckte Kuh. Die Rasse entsteht vor 300 Jahren durch Kreuzung von Kühen aus der Franche-Comté, also der Freigrafschaft Burgund südlich von Montbéliard, und Simmentalern aus dem Berner Oberland. Die bringen protestantische Mennoniten mit, die in Montbéliard Asyl finden. In Frankreich sind fast 20 % der Kühe Montbéliardes. Nur kurz erwähnt sei eine weitere Berühmtheit von Montbéliard, die Autofabrik Peugeot. Zu württembergischen Zeiten betreibt die Familie Peugeot eine Ölmühle in einem kleinen Ort, 10 km südlich von Montbéliard. Daraus entsteht eine Eisengießerei, dann werden landwirtschaftliche Geräte, Pfeffer- und Kaffeemühlen und Fahrräder hergestellt, bis im Jahr 1896 die Autoproduktion beginnt, ab 1912 im Stammwerk in Sochaux, einem Vorort von Montbéliard. Aber der Aufstieg der Firma Peugot hat nichts, auf jeden Fall nichts unmittelbar mit Württemberg zu tun, deshalb erwähne ich das hier nur als Fußnote.
Aber eine Frage steht jetzt im Raum: Woher rührt diese ungeheure Produktivität, die kulturelle Fruchtbarkeit der kleinen Grafschaft?
Ich denke, die Mischung macht's: Französische Sprache und Kultur, württembergische Einflüsse, nicht zuletzt die Religion, der Protestantismus, der aber nicht radikal durchgesetzt wird, werden kann, weil die katholischen Einflüsse aus der Umgebung viel zu stark waren. Eine württembergische Errungenschaft ist sicher die allgemeine Schulpflicht, die in Montbéliard schon früher als in Württemberg und viel früher als im benachbarten Frankreich eingeführt wird, nämlich im Jahr 1559. Bezweckt hat die Obrigkeit damit, dass die Kinder die Bibel lesen. Aber die haben dann natürlich noch ganz andere Dinge gelesen - zum allgemeinen Nutzen.
Nun zum Tübinger Stift, der Ausbildungsstätte für die württembergischen Pfarrer und eben auch die aus Montbéliard. Bevor dort das geniale Trio infernal Friedrich Hegel, Friedrich Hölderlin und Friedrich Schelling studiert, absolviert Karl Friedrich Reinhard – noch ein Friedrich – Im Stift das Examen. Reinhard ist der Sohn eines evangelischen Pfarrers aus Schorndorf im Remstal, und nicht zu glauben, der Mann hat es bis zum französischen Außenminister gebracht.
Er wird 1761 geboren, ist 10 Jahre älter als die Generation von Hegel, Hölderlin und Scheling, durchläuft aber die selben Stationen: Klosterschule in Denkendorf, Seminar in Maulbronn, dann Tübinger Stift. Anschließend studiert er noch an der Universität Tübingen. Die Zeit im Seminar und am Stift beschreibt Reinhard als trübsinnig und freudlos. Das Theologiestudium bringt ihm nichts. Die Verhältnisse im Stift schildert es als durch Bevormundung und Zwang bestimmt. Erst sein anschließendes Studium an der Universität macht ihm Freude, vor allem das Sprachstudium, nicht zuletzt Französisch.
1787 geht er als Hauslehrer nach Bordeaux und beteiligt sich 2 Jahre später begeistert an der französischen Revolution, wird Mitglied in einem Jakobinerklub. Dann zieht er nach Paris und lernt dort wichtige Leute kennen, mit denen er sich befreundet und die ihn fördern; nicht zuletzt der bedeutende Politiker und Diplomat Charles-Maurice de Talleyrand. Mit ihrer Hilfe macht er Karriere im diplomatischen Dienst, wird Gesandter des revolutionären Frankreich in London und Neapel. Im Herbst 1793 wird Reinhard nach Paris zurückbeordert und entgeht nur knapp der Guillotine. Inzwischen hat nämlich die Terrorherrschaft begonnen und fast alle Ausländer werden als Konterrevolutionäre verdächtigt. Aber Reinhard hat damals und auch später Glück.
Während der anschließenden Herrschaft des Directoire wird er als Botschafter in die deutschen Hansestädten geschickt, dann in die Toskana. 1799 ernennt ihn das Directoire zum Außenminister. Er bleibt aber nur zweieinhalb Monate im Amt, dann ergreift Napoleon die Macht. Aber auch der verwendet Reinhard weiter als Gesandten. Auf einer seiner Reisen im Auftrag Napoleons lernt er Goethe kennen und befreundet sich mit ihm.
Nach der Verbannung Napoleons erreicht Reinhard mithilfe seiner Freunde, dass er weiter im diplomatischen Dienst bleiben kann, sowohl unter Ludwig XVIII. und Charles X. als auch unter dem Bürgerkönig Louis Philippe. Erst wird er als Gesandter nach Frankfurt zum Deutschen Bund geschickt, dann nach Dresden. Schließlich beruft ihn Louis Philippe als Pair in die 2. französische Kammer, sozusagen das französische Oberhaus. Reinhard stirbt 1837 in Paris und ist auf dem Friedhof Montmartre begraben.
Was zieht einen protestantischen Pfarrersohn aus Schorndorf nach Frankreich und warum begeistert er sich für die Revolution? Reinhard schreibt am Ende seines Lebens an einen Freund:
„Mein Jugendinstinkt: Menschenrecht durch das Gesetz anerkannt und in den Schranken des Gesetzes ausgeübt, hat sich in den ersten Jahren der Revolution entwickelt, geläutert und festgesetzt (…). Wie Erfahrungen und Jahre sie beschränken und modifizieren mochten, die Idee bleibt immer“.
Reinhards Jungendinstinkt ist also schon vor der französischen Revolution entstanden, im Übrigen war er 1789 schon 28 und kein Jugendlicher mehr. Wahrscheinlich entsteht dieser Instinkt schon in Reinhards Tübinger Zeit, wird dort durch Studienkollegen und Freunde geschärft und bestätigt. Und vielleicht spielen dabei auch einige Mömpelgarder eine Rolle. Es ist möglich, aber wir wissen es nicht genau.
Mehr wissen wir über die Jahre im Tübinger Stift von Hegel, Hölderlin und Schelling, recht viel sogar über Hölderlin, und zwar dank des französischen Germanisten Pierre Bertaux.
Kurze Abschweifung: Bertaux hat ein aufregendes und vor allem engagiertes Leben geführt. 1936 wird er mit seiner Dissertation „Hölderlin. Essai de biographie intérieure” zum damals jüngsten Docteur des lettres in Frankreich promoviert. 1969 schreibt er ein sehr schönes Büchlein, “Hölderlin und die Französische Revolution“. Und in den 70ern des letzten Jahhunderts kommt dann eine richtig dicke Hölderlin-Biographie dazu. Aber Bertaux ist nicht nur Germanist, sondern auch Politiker und Geheimdienstfachmann in der Résistance. Wahrscheinlich wird er deshalb 1949 zum Direktor der Sûreté nationale, der nationalen Polizei, ernannt und bleibt es bis 1951. Von 1958 bis 1981 ist Bertaux Professor für Germanistik, erst in Lille, dann an der Sorbonne in Paris.
Im Vorwort zu „Hölderlin und die Französische Revolution“ schreibt er: „Hölderlins Dichtung eine politische Bedeutung beizumessen, galt der (west)deutschen Hölderlin-Forschung noch bis vor kurzem als Häresie. (…) Hölderlin ein Jakobiner? Undenkbar! Er war ein Schwärmer, ein Poet und gar ein geistig Umnachteter.“
Und noch schlimmer war das Hölderlin-Bild vor 1945. Von der Feier zum 100. Todestag im Jahr 1943 wird erzählt, dass die uralte Schriftstellerin Isolde Kurz, die zwar politisch keineswegs lupenrein, aber doch ziemlich hellsichtig war, nach den Reden, die am Grab im Tübinger Stadtfriedhof gehalten wurden, lauthals gesagt habe: „Langer Rede kurzer Sinn, Parteigenosse Hölderlin:“
Das war er bestimmt nicht und Bertaux belegt seine Auffassung mit zwei Zitaten. Seiner Schwester Rike schreibt Hölderlin im Juni 1792: „Glaube mir, liebe Schwester, wir kriegen schlimme Zeiten, wenn die Österreicher gewinnen. Der Missbrauch fürstlicher Gewalt wird schrecklich werden. Glaube das mir! und bete für die Franzosen, die Verfechter der menschlichen Rechte“. Und einmal unterzeichnet er mit: „un ci-devant révolutionaire wurtembergeois, nommé Hoelderlin.“
Bertaux schreibt über Hölderlin, aber natürlich beschäftigt er sich auch mit dessen berühmten Zimmergenossen, Friedrich Hegel und Friedrich Schelling: „In den Jahren, die Hölderlin und Hegel gemeinsam im Tübinger Stift verbrachten, bildete sich ihre Gesinnung. Die Jahre 1789 bis 93 waren die Jahre der Revolution in Frankreich.“
Hegel schreibt nach der Tübinger Zeit an Schelling. „Vernunft und Freiheit bleiben unsere Losung“. Und von Hölderlin haben wir schon gehört, dass er sich als 'révolutionaire wurtembergois' bezeichnet.
Zunächst verstehen sich die drei aber einfach gut, wohnen gern in einer Stube, es entsteht eine gute Atmosphäre. Hölderlin schreibt seiner Schwester im November 1790: „Wie es mir auf meiner Stube gefalle? Herrlich, liebe Rieke. (…) Das Zimmer ist eines der besten (…). Hegel ist auf meiner Stube und die Wenigen andern sind auch brave Leute, darunter (…) Schelling.“
Auch brave Leute gründen im Stift einen geheimen Jakobinerclub, der sich wohl zunächst als Lesegesellschaft tarnt. Man liest verbotene französische Zeitungen und verschlingt die neuesten Pariser Nachrichten. Der Initiator des Clubs, Christian Wetzel, bezahlt nachweislich 3 Gulden für Zeitungsabonnements und von Schelling ist bekannt, dass er die Marseillaise übersetzt hat. Der Geheimbund wird jedoch verraten und Christian Wetzel muss zweimal 12 Stunden Karzer absitzen.
In den Karzer kommen auch sogenannte „Mömpelgarder“. Aus unbekannten Gründen wird im August 1790 gegen Bernard, Bouillon, Fallot und Lambercier 24 bzw. 12 Stunden Karzer verhängt. 1792 besucht der württembergische Herzog Carl Eugen das Stift. Er habe (…) die Stipendiaten scharf durchgezogen, besonders zwei Mömpelgarder, berichtet ein Freund Hölderlins seinem Vater. Ja, die Mömpelgarder sind bei der Obrigkeit alles andere als beliebt, weil man sie der Verbreitung aufrührerischer Gedanken verdächtigt – nicht zu Unrecht. So schreiben Fallot und Bernard in das Stammbuch eines Stiftlers: „(...)Freiheit, Freiheit / Silberton dem Ohre / Dem Verstande Licht / Dem Herzen groß Gefühl!
Tübingen, im Maienmonde 1792 – Schreibs zum Andenken, Dein demokratischer Freund Bernard de Montbéliard. Vive la Liberté et la Constitution francaise!“
Und im September 1792 schreibt Hölderlin ins Stammbuch eines anderen Stifts-Studenten eine Strophe seine Hymne an die Menschheit. Auf dem demselben Blatt schreiben Fallot und Bernard: „La meilleure lecon que j'aie à te donner, c'est de ne plus être aristocrate. Souviens-toi de ton ami, G.F. Fallot, bon patriote. Symbole: Mort ou liberté.“Bernard schreibt noch dazu: „Egalité!“